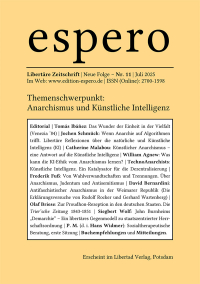espero - Nr. 11
Art.Nr.: espero_NF_006-2023-01
|
espero – Libertäre Zeitschrift (Neue Folge), Nr. 11, Juli 2025. |
Editorial:
Anfangs waren wir selbst in der Redaktion skeptisch, wie lange wir es schaffen würden, halbjährlich eine neue Ausgabe unserer undogmatisch-libertären Zeitschrift espero als Open-Access-Publikation (d. h. für unsere Leser:innen kostenlos) herauszubringen. Doch inzwischen erscheint espero seit fünf Jahren regelmäßig in einer Sommer- und Winterausgabe – und wir freuen uns nicht nur über eine stetig wachsende Zahl engagierter Leser:innen, sondern auch über die Vergrößerung unseres Redaktionsteams. Wir möchten Lena, Leon und Lisa herzlich an Bord der espero begrüßen, die das Projekt seit einigen Monaten unterstützen und an dieser Ausgabe mitgewirkt haben.
Aber in Zeiten wie diesen gibt es keine ungetrübte Freude. Wohin wir auch schauen: Krisen überall – Kriege in Gaza, der Ukraine, im Sudan; reaktionäre Kräfte und autoritäre Regime auf dem Vormarsch; wachsende soziale Ungleichheit; die Klimakatastrophe. Kein Wunder, dass die Menschen wütend werden, verzweifeln und resignieren. Doch diese Gefühle sind gefährlich: Sie öffnen Tür und Tor für reaktionäre Kräfte, für sozialen und politischen Zynismus – und letztlich für den Faschismus.
Es mangelt nicht an kritischen Analysen, die sich aus libertärer Sicht mit den Ursachen dieser Krisen beschäftigen. Aber was jetzt gebraucht wird, sind praktische Gegenentwürfe, die zeigen, dass ein Leben ohne Herrschaft kein fernes Ideal, sondern gelebte Realität sein kann. Eine solche „gelebte Anarchie“ beschreibt Tomás Ibáñez in seinem Gast-Essay über das legendäre Internationale Anarchistische Treffen 1984 in Venedig.
 Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich dem Verhältnis von Anarchismus und Künstlicher Intelligenz – einem Thema, das angesichts der rasanten technologischen Entwicklung und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen existenzielle Fragen für die Menschheit aufwirft. Jochen Schmück beleuchtet in seinem Beitrag die Wechselbeziehung zwischen natürlicher und Künstlicher Intelligenz. Er zeigt, dass anarchistische Prinzipien wie Dezentralisierung, Selbstorganisation und kollektive Entscheidungsfindung der kritischen KI-Forschung helfen können, ein libertäres Gegenmodell zur KI der Tech-Oligarchen zu entwickeln – ein Modell, in dem die kollektive menschliche Intelligenz und die KI der Maschinen herrschaftsfrei interagieren und sich wechselseitig bereichern.
Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich dem Verhältnis von Anarchismus und Künstlicher Intelligenz – einem Thema, das angesichts der rasanten technologischen Entwicklung und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen existenzielle Fragen für die Menschheit aufwirft. Jochen Schmück beleuchtet in seinem Beitrag die Wechselbeziehung zwischen natürlicher und Künstlicher Intelligenz. Er zeigt, dass anarchistische Prinzipien wie Dezentralisierung, Selbstorganisation und kollektive Entscheidungsfindung der kritischen KI-Forschung helfen können, ein libertäres Gegenmodell zur KI der Tech-Oligarchen zu entwickeln – ein Modell, in dem die kollektive menschliche Intelligenz und die KI der Maschinen herrschaftsfrei interagieren und sich wechselseitig bereichern.
Catherine Malabou, eine der profiliertesten Stimmen der Gegenwartsphilosophie, unterscheidet zwei Szenarien des Kontrollverlustes durch KI: die dystopische Maschinenherrschaft und eine emanzipatorische Vision – den freiwilligen Verzicht auf individualistische Macht zugunsten einer symbiotischen Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Diese Verbindung soll traditionelle Machtstrukturen überwinden und durch Plastizität eine Gesellschaft jenseits von Hierarchie und Herrschaft ermöglichen. Malabou entwirft ein neues Verständnis von ontologischem Anarchismus, der Technik nicht ablehnt, sondern als disruptives Potenzial akzeptiert. Dieser Anarchismus verweigert sich festen Wahrheiten – er entfaltet sich im offenen Denken jenseits festgeschriebener ideologischer Leitlinien.
Der US-amerikanische KI-Forscher William Agnew entwickelt eine radikale KI-Ethik, die anarchistische Prinzipien mit der modernen KI-Technologie verbindet. Ziel ist der Abbau hierarchischer Strukturen und die Dezentralisierung von Kontrolle. KI-Ethik, so seine Forderung, muss zur Speerspitze gesellschaftlicher Selbstbestimmung werden – nicht zum Feigenblatt der Tech-Eliten. Noch weiter in eine erklärt anarchistische Richtung gehen die TechnoAnarchisten: Sie fordern auf, die Künstliche Intelligenz zu hacken, um sie als Open-Source-KI für Selbstorganisation, Commons, Kooperation und nachhaltiges Leben zu nutzen. Die Beiträge des Specials zeigen: Im Schatten der Tech-Konzerne entsteht ein neuer Anarchismus, der darauf abzielt, die KI-Technologie von ihren kapitalistischen Fesseln zu befreien und die Kontrolle über die Algorithmen den Mächtigen zu entwinden, um sie zurück in die Hände der Gesellschaft zu legen.
Weitere Beiträge widmen sich anderen Themen: Fredrik Fuß analysiert das Verhältnis von Anarchismus und Judentum, insbesondere im Umgang mit Antisemitismus und Zionismus. Er zeigt, wie sich Ideale und Abgründe selbst in progressiven Strömungen durchdringen. Die Frage, warum Gesellschaften anfällig für autoritäre Versuchungen bleiben, ist aktueller denn je. Bei eben dieser Frage setzt David Bernardini an, der sich mit den libertären Faschismus-Analysen von Rudolf Rocker und Gerhard Wartenberg beschäftigt. Ihre Analysen liefern Einblicke in die Mechanismen von Populismus und Radikalisierung zur Zeit der Weimarer Republik.
Mit Olaf Brieses Beitrag springen wir zurück ins 19. Jahrhundert – in eine Epoche, in der progressive Köpfe im rheinischen Blätterwald auf die soziale Frage antworteten und dabei die Anarchie entdeckten. Briese beleuchtet den Einfluss von Pierre-Joseph Proudhon auf das liberal-sozialistische Milieu Deutschlands, insbesondere durch die Trier’sche Zeitung, die als erste sozialistische Tageszeitung den „libertären Sozialismus“ bekannt machte. Er zeigt, wie diese Zeitung, entgegen späterer marxistischer Diffamierung, ein pluralistisches Forum für Ideen wie Mutualismus, Selbstorganisation und Tauschbanken bot – Konzepte zur radikalen Neugestaltung jenseits staatlicher Bevormundung.
In einer Zeit, in der das Vertrauen in repräsentative Demokratie schwindet und autokratische Systeme erstarken, stellt Siegbert Wolf mit dem Konzept der „Demarchie“ ein libertäres Alternativmodell vor. Es geht auf den australischen Philosophen John Burnheim zurück und projektiert eine Gesellschaft ohne zentrale staatliche Verwaltung. Entscheidungen werden von Gremien getroffen, deren Mitglieder per Los bestimmt werden, und zwar in repräsentativer Auswahl aus denjenigen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind. Burnheims Modell ist ein mutiger Entwurf für Selbstorganisation und soziale Teilhabe.
Angesichts globaler Krisen stellt sich die Frage: Gibt es einen Ausweg? Diese Frage greift der durch seine anarchistische Utopie bolo’bolo bekannte Schweizer Autor P. M. (Hans Widmer) in einem literarischen Beitrag auf – ein imaginäres „sozialtherapeutisches Beratungsgespräch“, in dem er einen Zehnjahresplan zur Transformation unseres Planeten entwirft. Seine Botschaft: Nur ein Bruch mit dem Tauschprinzip und eine solidarische Geben-und-Nehmen-Kultur sichern langfristig unser Überleben.
Zum Abschluss enthält diese Ausgabe wie gewohnt Buchempfehlungen und redaktionelle Mitteilungen. Jochen Schmück und Markus Henning beleuchten in ihren Besprechungen das emanzipatorische Potenzial alternativer politischer und ökologischer Ansätze, während Siegbert Wolf in seiner an die anarchistische Szene gerichteten Rezension zu einem konsequenten und historisch reflektierten Kampf gegen den Antisemitismus aufruft.
Wir wünschen unseren Leser:innen eine anregende Lektüre!
Das espero-Redaktionskollektiv:
Jochen, Knobi, Lena, Leon, Lisa, Markus und Rolf
Preis:
1,00 EUR
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten